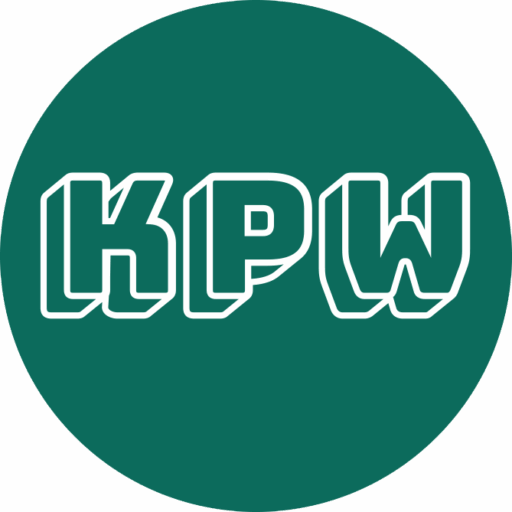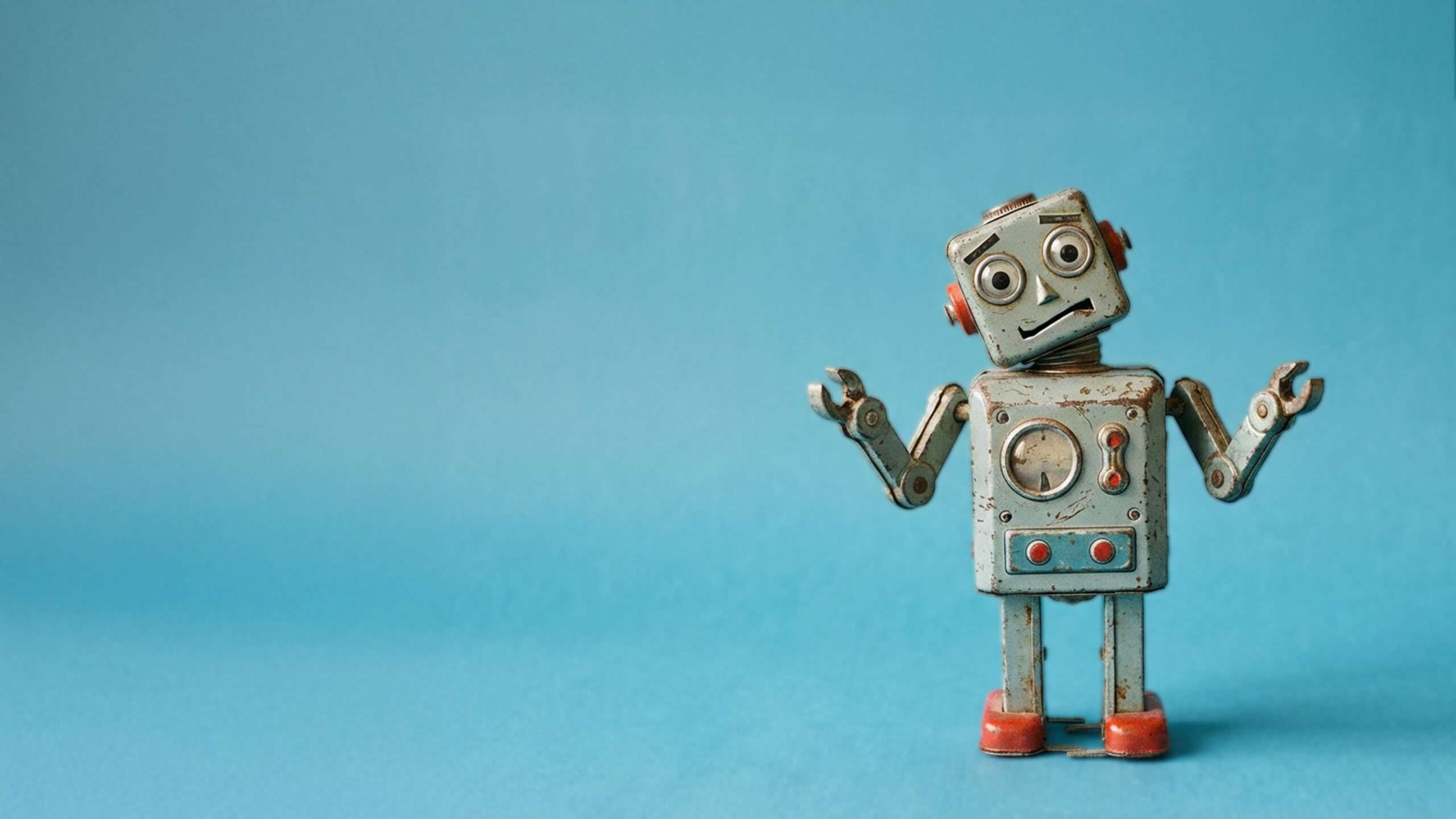Hintergrundwissen
Welchen Schutz
geniesst ein
Lichtbild?
Welchen Schutz
geniesst ein
Lichtbild?
Lichtbildschutz in Deutschland
Das deutsche Urheberrecht schützt nicht nur künstlerisch wertvolle Werke, sondern auch einfache Fotografien durch das sogenannte Lichtbildrecht. Für Fotografen, Unternehmen und Privatpersonen ist es wichtig zu verstehen, welche Rechte an Bildern entstehen und wie diese durchgesetzt werden können.
Was ist ein Lichtbild?
Gemäß deutschem Urheberrecht ist ein Lichtbild jede durch ein fotografisches Verfahren oder ein ähnliches Verfahren hergestellte Aufnahme. Der Begriff ist bewusst weit gefasst und umfasst sowohl digitale Fotografien, die mit Kameras oder Smartphones angefertigt werden, als auch analoge Fotografien auf Film. Darüber hinaus zählen auch Röntgenaufnahmen, Mikroskopaufnahmen, Satellitenbilder und Screenshots von Bildschirminhalten dazu.
Für den Lichtbildschutz ist es unerheblich, ob die Aufnahme künstlerischen Wert besitzt oder nur dokumentarischen Charakter hat. Auch einfache Produktfotos oder spontane Schnappschüsse genießen rechtlichen Schutz. Eine mit dem Smartphone aufgenommene Aufnahme des Mittagessens für Instagram ist ebenso als geschütztes Lichtbild zu betrachten wie eine professionelle Werbeaufnahme oder ein Urlaubsfoto.
Wie entsteht das Recht am Lichtbild?
Das Lichtbildrecht entsteht automatisch mit der Herstellung der Aufnahme, ohne dass eine Registrierung oder sonstige Formalitäten erforderlich wären. Für die Zuordnung ist maßgeblich die Person verantwortlich, die die Aufnahme angefertigt hat. Derjenige ist rechtlich der sogenannte Lichtbildner.
Was ist mit KI-generierten Bildern?
Bilder die mit künstlicher Intelligenz hergestellt werden, unterfallen nicht dem Lichtbildschutz. Der Lichtbildschutz setzt voraus, dass das Lichtbild fotografisch oder fotografieähnlich erzeugt wurde. Bei computergenerierten Bildern ist dies nicht der Fall.
Rechte des Lichtbildners
Dem Inhaber des Lichtbildrechts kommen verschiedene ausschließliche Befugnisse zu. Das Vervielfältigungsrecht gibt dem Urheber die Kontrolle darüber, wer das Bild kopieren oder reproduzieren lassen darf. Dies umfasst sowohl digitale Kopien als auch Ausdrucke oder die Speicherung auf Datenträgern.
Das Verbreitungsrecht ermöglicht es dem Rechtsinhaber, die erste Veräußerung des Bildes zu kontrollieren. Nach dem ersten rechtmäßigen Verkauf ist eine Weiterveräußerung grundsätzlich frei möglich. In der digitalen Welt ist das Recht der öffentlichen Wiedergabe von besonderer Relevanz. Es umfasst die Veröffentlichung in Zeitschriften oder auf Websites, die Ausstellung in Galerien oder öffentlichen Räumen sowie die Verwendung in sozialen Medien.
Schließlich steht dem Lichtbildner auch ein Bearbeitungsrecht zu, wodurch er die Kontrolle über Veränderungen am Bild behält. Hierunter fallen Farbänderungen, Beschneidungen oder die Einbindung in Montagen.
Rechtsverletzungen und Durchsetzung
Häufige Verletzungshandlungen umfassen die unerlaubte Verwendung von Bildern auf Websites, das Weiterleiten oder Teilen ohne entsprechende Genehmigung, die kommerzielle Nutzung ohne gültige Lizenz sowie die Bearbeitung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers.
Im Falle einer Rechtsverletzung hat der Lichtbildner verschiedene Ansprüche, die er im Wege der Abmahnung geltend machen kann. Der Unterlassungsanspruch ermöglicht die sofortige Einstellung der rechtswidrigen Nutzung und die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung durch den Verletzer.
Darüber hinaus kann Schadensersatz verlangt werden, wobei der Geschädigte zwischen verschiedenen Berechnungsmethoden wählen kann. Er kann den entgangenen Gewinn geltend machen, die Herausgabe des Verletzergewinns verlangen oder eine angemessene Lizenzgebühr als sogenannte fiktive Lizenz fordern. Sollte ein professioneller Fotograf feststellen, dass sein Bild ohne seine Erlaubnis für Werbezwecke verwendet wird, kann er eine angemessene Lizenz als Schadensersatz verlangen. Die Höhe der Lizenzgebühren bemisst sich nach der Art der Nutzung und liegt in der Regel bei mehreren hundert Euro.
Zusätzlich besteht ein Anspruch auf Auskunft, durch den der Rechtsinhaber Informationen über den Umfang der Rechtsverletzung erhält.
Schutzdauer von Lichtbildern
Das Lichtbildrecht ist zeitlich begrenzt und erlischt 50 Jahre nach der Herstellung der Aufnahme. Dabei beginnt die Frist mit Ablauf des Kalenderjahres der Herstellung. Maßgeblich ist das Entstehungsdatum und nicht etwa die spätere Veröffentlichung. Nach Ablauf dieser Frist wird das Bild gemeinfrei und kann von jedermann frei verwendet werden. Ein beispielsweise 1970 aufgenommenes Foto ist seit dem 31. Dezember 2020 nicht mehr geschützt.
Unterschied zwischen Lichtbild und Lichtbildwerk
Das Urheberrecht unterscheidet zwischen einfachen Lichtbildern und künstlerisch wertvollen Lichtbildwerken. Ein Lichtbildwerk setzt eine persönliche geistige Schöpfung mit individueller Gestaltungshöhe und künstlerischem oder ästhetischem Wert voraus. Hierzu zählen etwa künstlerische Porträts, aufwendige Landschaftsfotografien oder kreative Kompositionen. Der Schutz erstreckt sich bei Lichtbildwerken über 70 Jahre nach dem Tod des Fotografen, und es bestehen regelmäßig höhere Schadensersatzansprüche.
Im Gegensatz dazu erfordert ein einfaches Lichtbild keine besondere Gestaltungshöhe. Jede fotografische Aufnahme kann als Lichtbild geschützt sein, unabhängig von ihrem künstlerischen Wert. Der Schutz beträgt 50 Jahre ab Herstellung und basiert auf verwandten Schutzrechten. Hierunter fallen beispielsweise Produktfotos, Dokumentationsaufnahmen oder spontane Schnappschüsse.
In der Praxis ist die Unterscheidung zwischen beiden Schutzformen allerdings oft schwierig.
Praktische Empfehlungen
Lichtbildner sollten ihre Fotografien mit entsprechenden Metadaten und Copyright-Vermerken versehen, um ihre Urheberschaft zu dokumentieren. Bei geplanter kommerzieller Nutzung empfiehlt es sich, klare Lizenzverträge abzuschließen. Rechtsverletzungen sollten zeitnah verfolgt werden, und es ist ratsam, Beweise für die eigene Urheberschaft zu sammeln und sicher aufzubewahren.
Nutzer von Bildmaterial sollten grundsätzlich nur lizenzierte Bilder, lizenzfreie Bilder oder eigene Aufnahmen verwenden. Bei Unsicherheit über die Rechtslage ist es empfehlenswert, rechtliche Beratung einzuholen. Creative Commons-Lizenzen müssen beachtet und ihre Bedingungen eingehalten werden. Im Zweifel sollten entsprechende Nutzungsrechte ordnungsgemäß erworben werden.
Unternehmen sollten ihre Mitarbeiter regelmäßig über Bildrechte schulen und klare Regelungen für die Social Media-Nutzung etablieren. Für Marketingzwecke sollten professionelle Bildlizenzen genutzt werden, und durch entsprechende Compliance-Systeme können Rechtsverletzungen von vornherein vermieden werden.
Unser Team
zum Urheberrecht
Unser Team
zum Urheberrecht