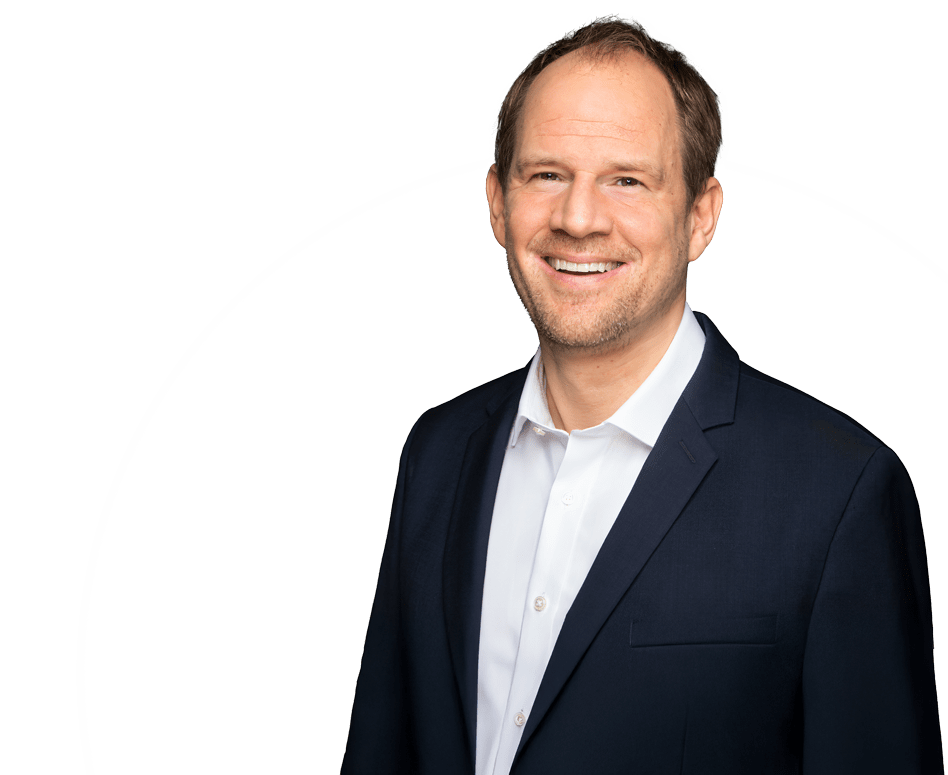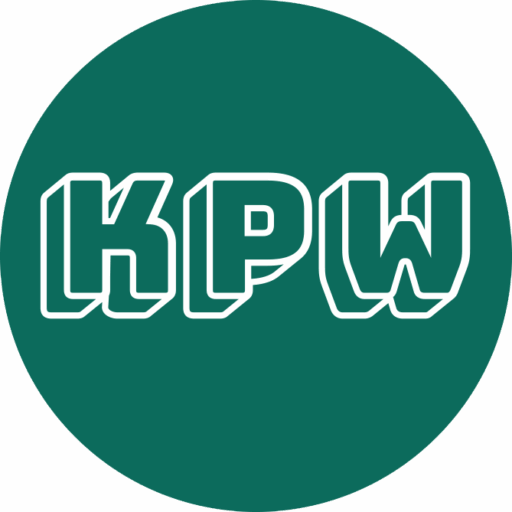Ist
Coaching
Fernunterricht?
Ist
Coaching
Fernunterricht?
von
Ist Coaching Fernunterricht? Über diese Frage gab und gibt es unterschiedlich Auffassungen in der Rechtsprechung. Einige Fragen zum Fernunterricht hat der Bundesgerichtshof nun entschieden.
Ist Online Coaching Fernunterricht?
In Rechtsprechung und Literatur herrscht bislang Uneinigkeit darüber, wann und unter welchen Bedingungen Coaching Fernunterricht im Sinne des Fernunterrichtsschutzgesetzes (FernUSG) ist oder nicht. Das ist von großer Bedeutung, denn unterfällt ein Angebot dem FernUSG, besteht eine Zulassungspflicht des Anbieters. Wird Fernunterricht ohne Zulassung angeboten, ist der Vertrag nichtig. Damit entfällt der Zahlungsanspruch für den Anbieter und bereits gezahlte Teilnahmegebühren können vom Teilnehmer zurückgefordert werden.
Fernunterricht im Sinne des FernUSG liegt vor, wenn auf vertraglicher Grundlage die entgeltliche Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten erfolgt, der Lehrende und der Lernende ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt sind und eine Lernerfolgskontrolle stattfindet.
Im Kern geht es um die Frage, ob bei „Coaching“ das FernUSG überhaupt anwendbar ist. Stehen beim Coaching die Vermittlung von „Kenntnissen und Fähigkeiten“ im Vordergrund oder eher die individuelle und persönliche Beratung und Begleitung des Kunden. Viele Coaching-Angebote sind hybrid gestaltet und enthalten Elemente beider Bereiche, was die Abgrenzung erschwert. Macht es einen Unterschied, ob das Coaching B2B oder B2C stattfindet? Was bedeutet räumliche Trennung? Gilt dies auch für Coachings mittels Videokonferenzen? Zwischen verschiedenen Gerichten herrschte zu diesen Fragen bislang Uneinigkeit. Nun hatte der BGH die Gelegenheit etwas Klarheit zu schaffen.
Der Coaching Fall vor dem BGH
Gegenstand des Verfahrens vor dem BGH war ein Rechtsstreit über Zahlungsansprüche aus einem Vertrag über ein **“9-Monats-Business-Mentoring-Programm Finanzielle Fitness“**. Dieses Programm wurde von einem Unternehmen angeboten, was sich selbst als Akademie bezeichnete. Mit dem Angebot sollten sich Menschen unternehmerische Fähigkeiten aneignen. Die Programmbeschreibung hob hervor, dass das komplette Know-How der beiden Unternehmer an die Teilnehmer weitergegeben werde und das Programm auf effizienten Wachstumsstrategien auf einem starken Fundament auf: ein starkes Mindset – die Art wie erfolgreiche Unternehmer denken und handeln aufbauen. Es wurde als vollgepackt mit dem Know-How aus der Praxiserfahrung in Unternehmensführung und -aufbau beschrieben und sollte den Teilnehmern eine erhebliche Verkürzung des Wissensaufbaus verschaffen, wobei das Ziel die Umsetzung und Ergebnisse waren. Konkrete Bestandteile des Programms waren zweiwöchentliche Online-Meetings, Hausaufgaben, Klärung von Fragen in Meetings, per E-Mail oder in einer Facebook-Gruppe, sowie die Möglichkeit von zwei Online-Einzelsitzungen bei einem Personal-Coach zur Auflösung persönlicher Blockaden. Zudem waren pro Halbjahr intensive Workshops zu Themen wie Mindset und Strategien vorgesehen. Die regelmäßigen Online-Meetings wurden aufgezeichnet und den Teilnehmern nachträglich zur Verfügung gestellt und es gab Lehrvideos mit Lektionen zum Durcharbeite. Das Programm versprach den Teilnehmern, Grundvoraussetzungen [zu] bieten, Ihre finanzielle Freiheit zu erschaffen und mehrere Einkommensströme aufbauen zu können. Für dieses umfassende Programm lag keine Zulassung nach dem FernUSG vor.
Die Entscheidung des BGH zum Coaching und Fernunterricht
Der BGH hat in mit Urteil vom 12.06.2025 – Az. III ZR 109/24 einige Klarstellungen zur Anwendbarkeit des Fernunterrichtsschutzgesetzes (FernUSG) auf Coaching- und Mentoring-Programme vorgenommen.
Der BGH hat entschieden, dass das konkrete Coaching-Programm Fernunterricht nach dem FernUSG sei. Dabei hat der BGH einige in der Rechtsprechung umstrittenen Punkte geklärt:
Anwendbarkeit des FernUSG auch auf B2B-Verträge
Ein zentraler Punkt des Urteils ist die Feststellung, dass das FernUSG nicht auf Verbraucherverträge im Sinne des § 13 BGB beschränkt ist. Es findet vielmehr Anwendung auf alle Personen, die einen Fernunterrichtsvertrag schließen, unabhängig davon, ob dies zu gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Zwecken erfolgt. Dies ist eine Abkehr von der teilweise in Rechtsprechung und Literatur vertretenen Ansicht, die eine Beschränkung auf Verbraucher annahm. Der BGH begründet dies damit, dass der Gesetzgeber eine solche Einschränkung im Wortlaut des Gesetzes nicht vorgesehen hat und das Schutzkonzept des FernUSG gegenstandsbezogen ist, um alle potentiellen Teilnehmer vor ungeeigneten Fernlehrgängen zu schützen.
Asynchrone und synchrone Wissensvermittlung
Das FernUSG setzt eine „ausschließliche oder überwiegende räumliche Trennung zwischen Lehrendem und Lernendem“ voraus. Der BGH hat klargestellt, dass synchrone Online-Meetings, die zusätzlich aufgezeichnet und den Teilnehmern anschließend zur Verfügung gestellt werden, als asynchroner Unterricht zu behandeln sind. Dies liegt daran, dass sie zeitversetzt zu einem beliebigen Zeitpunkt angeschaut werden können und eine synchrone Teilnahme entbehrlich machen. Überwiegen solche asynchronen Anteile (wie im vorliegenden Fall durch Lehrvideos, Hausaufgaben und aufgezeichnete Online-Meetings), ist das Merkmal der räumlichen Trennung auch bei einer einschränkenden Auslegung erfüllt, die zusätzlich eine zeitlich versetzte (asynchrone) Darbietung fordert.
Im konkreten Fall sah der BGH zudem die Wissensvermittlung als deutlich im Vordergrund stehend an, da Lernziele vordefiniert waren, wiederholt auf „Wissen“, „Know-How“ und „finanzielle Bildung“ verwiesen wurde, die Beklagte ihren Unternehmensbereich als „Akademie“ bezeichnete und Gruppenveranstaltungen stattfanden. Die „Online-Einzelsitzungen bei einem Personal-Coach zur Auflösung persönlicher Blockaden“ fielen demgegenüber nicht ins Gewicht.
Überwachung des Lernerfolgs
Eine weitere Voraussetzung für Fernunterricht ist, dass „der Lehrende oder sein Beauftragter den Lernerfolg überwachen“. Der BGH legt dieses Merkmal weiterhin sehr weit aus: Es ist bereits erfüllt, wenn der Lernende nach dem Vertrag den Anspruch hat, beispielsweise in einer begleitenden Unterrichtsveranstaltung durch mündliche Fragen zum erlernten Stoff eine individuelle Kontrolle des Lernerfolgs zu erhalten. Eine einzige Lernkontrolle genügt. Im zu entscheidenden Fall bejahte der BGH dies, da die Programmbeschreibung ausdrücklich die Möglichkeit und das Recht vorsah, in Online-Meetings, per Mail oder in einer Facebook-Gruppe Fragen zu stellen, die sich jedenfalls auch auf das Verständnis des erlernten Stoffs beziehen. Auch das Stellen von Hausaufgaben kann ein Indiz für eine Lernerfolgsüberwachung sein. Unerheblich ist laut BGH dabei, ob die Lernerfolgsüberwachung tatsächlich stattfindet; entscheidend ist, dass sie vertraglich vorgesehen ist.
Auswirkungen auf die Coachingbranche und Risiken
Das Urteil des BGH hat weitreichende Konsequenzen für die Coachingbranche:
- Erweiterter Anwendungsbereich des FernUSG: Viele Coaching-Programme, die sich bisher nicht als „klassischen Fernunterricht“ verstanden haben, könnten nun unter das FernUSG fallen, selbst wenn sie sich an Unternehmen oder Selbstständige richten.
- Zulassungspflicht: Fällt ein Programm unter das FernUSG, bedarf es einer staatlichen Zulassung durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU). Ohne diese Zulassung ist ein Fernunterrichtsvertrag nichtig.
- Rückzahlungsansprüche: Bei Nichtigkeit des Vertrages haben die Teilnehmer einen Anspruch auf Rückzahlung der gesamten gezahlten Vergütung. Die Coaching-Anbieter müssen beweisen, dass den Teilnehmern durch die erbrachten Dienste entsprechende Aufwendungen erspart wurden, um einen Wertersatzanspruch geltend zu machen. Dieser Nachweis dürfte in der Praxis oft schwierig zu erbringen sein.
- Fehlende Wertersatzansprüche: Ohne den Nachweis ersparter Aufwendungen besteht kein zu saldierender Wertersatzanspruch für den Anbieter. Dies kann für Anbieter, die bereits Leistungen erbracht haben, erhebliche finanzielle Einbußen bedeuten.
Handlungsanweisungen für Coachinganbieter
Angesichts dieser Entwicklung sollten Coachinganbieter dringend ihre Angebote überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen, um rechtliche Risiken zu minimieren:
Prüfung der Anwendbarkeit des FernUSG
- Inhaltliche Analyse: Steht in Ihrem Programm die Vermittlung von „Kenntnissen und Fähigkeiten“ im Vordergrund (z.B. durch vordefinierte Lernziele, Verweise auf „Wissen“ oder „Know-How“, die Bezeichnung als „Akademie“)?
- Räumliche Trennung: Findet die Wissensvermittlung überwiegend räumlich getrennt statt (z.B. Online-Module, Videos, Aufgaben)? Beachten Sie, dass synchron abgehaltene, aber aufgezeichnete Online-Sitzungen als asynchron gelten können. Daher sollte auf Aufzeichnungen möglichst verzichtet werden.
- Lernerfolgskontrolle: Ist vertraglich eine Überwachung des Lernerfolgs vorgesehen (z.B. durch Fragerechte zu Lerninhalten, Hausaufgaben, Tests)? Eine einzige Kontrollmöglichkeit kann ausreichen.
Anpassung des Angebotes
- Fokus auf individuelle Beratung: Wenn Sie die Anwendung des FernUSG vermeiden möchten, sollten Sie den Schwerpunkt Ihres Angebots stärker auf die individuelle und persönliche Beratung und Begleitung legen, anstatt auf die standardisierte Wissensvermittlung. Dies erfordert eine klare vertragliche und inhaltliche Ausgestaltung.
- Reduzierung standardisierter Inhalte: Minimieren Sie den Anteil an vordefinierten Lernzielen, Lehrvideos, festen Modulen und standardisierten Hausaufgaben, wenn Sie nicht dem FernUSG unterfallen möchten.
- Keine oder minimale Lernerfolgskontrolle: Wenn Sie keine Fernunterrichtszulassung anstreben, sollten Sie vertraglich keine Mechanismen zur Überprüfung des „erlernten Stoffs“ vorsehen. Fragen sollten sich dann primär auf die individuelle Umsetzung oder persönliche Herausforderungen beziehen, nicht auf die Kontrolle des Wissenserwerbs.
- Prüfung und Anpassung der Verträge: Lassen Sie Ihre aktuellen Programm- und Vertragsunterlagen prüfen und passen Sie Ihre Verträge und Programmbeschreibungen präzise an die neue Rechtslage an, um Missverständnisse und rechtliche Risiken zu vermeiden.
Zulassung als Fernunterrichtsanbieter
Sollte Ihr Angebot unter das FernUSG fallen und sind Anpassungen die eine Anwendbarkeit ausschließen nicht gewollt oder möglich, sollte eine Zulassung bei der ZFU beantragt werden. . Eine fehlende Zulassung führt zur Nichtigkeit des Vertrages und damit zu Rückzahlungsansprüchen der Teilnehmer.
Fazit
Das BGH-Urteil unterstreicht die Notwendigkeit für Coachinganbieter, sich intensiv mit den Vorgaben des FernUSG auseinanderzusetzen. Eine proaktive Prüfung, Anpassung der Angebote und Prozesse ist entscheidend, um Rechtssicherheit zu schaffen morgen und kostspielige rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Andernfalls drohen Rückforderungen von Zahlungen durch Teilnehmer. Bei Fragen zur rechtlichen Einordnung Ihres spezifischen Coachingangebots und zur Entwicklung einer passenden Strategie stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir beraten
Sie gerne zu
diesem Thema!