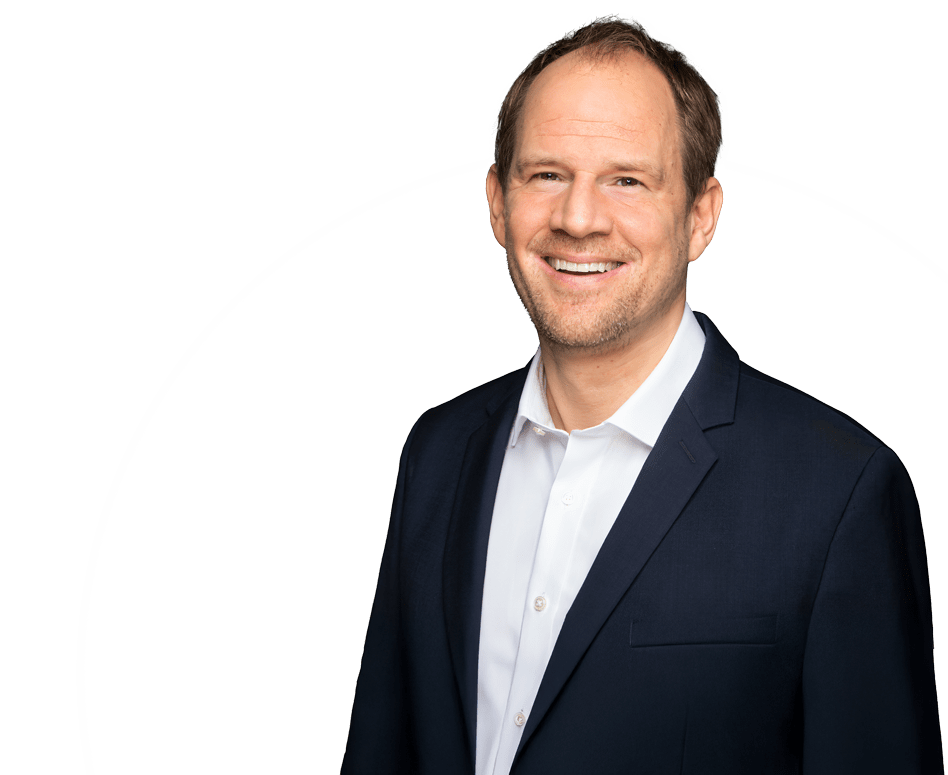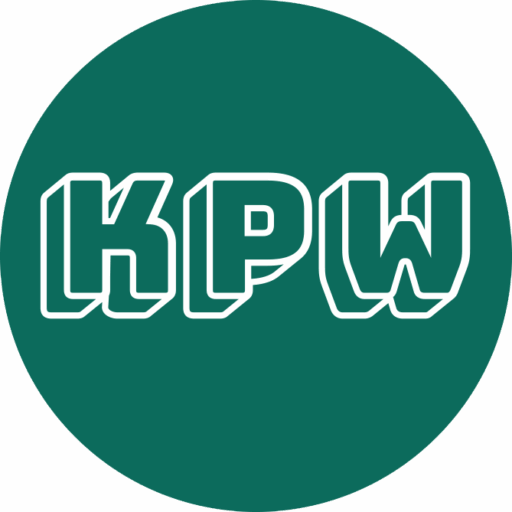Nationale Marke
wirkt
über grenzen.
Nationale Marke
wirkt
über grenzen.
von
Kann ein deutscher Markeninhaber gegen einen im EU-Ausland sitzenden Onlinehändler vorgehen, wenn dieser dort rechtsverletzende Ware besitzt? Oder ist der Markeninhaber mangels Rechten in dem Land schutzlos?
Worum geht’s?
Der Europäische Gerichtshof hat am 1. August 2025 eine wegweisende Entscheidung zum Markenrecht getroffen, die das Verhältnis zwischen territorialen Schutzrechten und dem grenzüberschreitenden Online-Handel neu definiert. Deutsche Markeninhaber können unter bestimmten Umständen künftig auch Dritten verbieten, markenverletzende Waren in anderen EU-Mitgliedstaaten zu besitzen – vorausgesetzt, diese Waren sind für den deutschen Markt bestimmt.
Hintergrund des Falls
Der Rechtsstreit entwickelte sich aus einem typischen grenzüberschreitenden E-Commerce-Konflikt, wie er im EU-Binnenmarkt täglich vorkommt. Der deutsche Markeninhaber PH verfügt über eingetragene Wort-Bild-Marken für Taucherapparate und Tauchzubehör, die beim Deutschen Patent- und Markenamt registriert sind. Diese Marken schützen verschiedene Produkte wie Taucheranzüge, Taucherhandschuhe, Tauchermasken und Atemgeräte zum Tauchen.
Das spanische Unternehmen Tradeinn Retail Services nutzte Zeichen, die mit diesen deutschen Marken identisch waren, um Tauchzubehör zu bewerben und zu verkaufen. Dabei bediente sich das Unternehmen sowohl seiner eigenen Website als auch der deutschen Amazon-Plattform amazon.de. Die beworbenen Waren befanden sich physisch in Spanien und wurden von dort aus an Kunden verschickt, die Verkaufsangebote richteten sich jedoch gezielt an deutsche Verbraucher.
Diese Konstellation führte zu einer komplexen Rechtsfrage:
Kann ein deutscher Markeninhaber gegen ein spanisches Unternehmen vorgehen, das zwar in Spanien ansässig ist und dort seine Waren lagert, aber gezielt deutsche Kunden anspricht?
Das Landgericht Nürnberg-Fürth bejahte dies zunächst und verurteilte Tradeinn Retail Services dazu, das Anbieten und Bewerben der markenverletzenden Waren zu unterlassen. Das Oberlandesgericht Nürnberg ging noch weiter und erweiterte das Verbot auch auf den Besitz der Waren „zu vorgenanntem Zweck“ – also um sie in Deutschland anzubieten oder in den Verkehr zu bringen.
Die EuGH-Entscheidung auf den Punkt
Der Europäische Gerichtshof entschied mit Urteil vom 01.08.2025 – Az. C‑76/24 nun zwei grundlegende Rechtsfragen, die für die Zukunft des Markenrechts im digitalen Binnenmarkt große Bedeutung haben dürften.
Territorialität trifft auf Online-Realität
Die erste und wohl wichtigste Frage betraf das Verhältnis zwischen dem Territorialitätsprinzip des Markenrechts und den grenzüberschreitenden Möglichkeiten des Online-Handels. Traditionell ist der Schutz einer nationalen Marke auf das Gebiet des Eintragungsmitgliedstaats beschränkt. Ein deutscher Markeninhaber kann normalerweise nur gegen Verletzungen vorgehen, die in Deutschland stattfinden.
Der EuGH erkannte jedoch, dass diese strenge territoriale Sichtweise der Realität des digitalen Binnenmarkts nicht mehr gerecht wird. Wenn ein Unternehmen gezielt deutsche Verbraucher über deutsche Online-Plattformen anspricht, kann es sich nicht darauf berufen, dass sich seine Waren physisch außerhalb Deutschlands befinden. Der Gerichtshof argumentierte, dass sich Online-Angebote auf Plattformen wie amazon.de erkennbar an deutsche Verbraucher richten und daher dem deutschen Markenrecht unterliegen.
Diese Erkenntnis führte zu einer bemerkenswerten Erweiterung der Durchsetzungsmöglichkeiten für Markeninhaber. Wenn das Anbieten von Waren in Deutschland rechtmäßig verboten werden kann, muss konsequenterweise auch der vorgelagerte Besitz dieser Waren verbietbar sein – unabhängig davon, wo sie sich physisch befinden. Andernfalls könnten Online-Händler durch geschickte Verlagerung ihrer Lagerstandorte jeder Verpflichtung zur Beachtung von Markenrechten entgehen. Das würde die praktische Wirksamkeit des europäischen Markenschutzes untergraben.
Mittelbarer Besitz als Anknüpfungspunkt
Die zweite Kernfrage betraf die Definition des Begriffs „Besitz“ in der EU-Markenrichtlinie. Die verschiedenen Sprachfassungen der Richtlinie verwenden unterschiedliche Begriffe: Während die deutsche Fassung von „besitzen“ spricht und die französische von „détenir“, verwenden andere Sprachfassungen Begriffe, die eher auf Lagerung abstellen, wie das englische „stocking“ oder das spanische „almacenar“.
Der EuGH stellte klar, dass diese sprachlichen Unterschiede nicht zu unterschiedlichen Rechtswirkungen führen dürfen. Entscheidend sei, dass jede Person, die unmittelbar oder mittelbar die Herrschaft über eine markenverletzende Handlung hat, auch tatsächlich in der Lage sein muss, diese Benutzung zu beenden. Daher umfasst der Begriff „Besitz“ nicht nur die unmittelbare und tatsächliche Herrschaft über die Waren, sondern auch den mittelbaren Besitz durch Ausübung einer Aufsichts- oder Leitungsbefugnis gegenüber der Person, die die unmittelbare Herrschaft innehat.
Diese Auslegung hat weitreichende praktische Konsequenzen. Ein Online-Händler kann sich nicht mehr darauf berufen, dass er die Waren einem Logistikdienstleister übergeben und damit die unmittelbare Herrschaft aufgegeben hat. Solange er über vertragliche oder tatsächliche Einflussmöglichkeiten auf den Lagerhalter verfügt, bleibt er als mittelbarer Besitzer haftbar.
Bedeutung für Unternehmen
Erweiterte Möglichkeiten für Markeninhaber
Die Entscheidung eröffnet deutschen und anderen nationalen Markeninhabern völlig neue Durchsetzungsstrategien. Bisher mussten sie sich darauf beschränken, gegen Verletzungshandlungen vorzugehen, die in ihrem Schutzgebiet stattfanden. Nun können sie auch gegen Vorbereitungshandlungen in anderen EU-Mitgliedstaaten vorgehen, sofern diese erkennbar auf ihr Schutzgebiet ausgerichtet sind.
Besonders relevant wird dies für die Bekämpfung von Online-Markenverletzungen. Markeninhaber müssen nicht mehr tatenlos zusehen, wie ihre Rechte über ausländische Online-Plattformen verletzt werden, nur weil sich die Waren physisch außerhalb ihres Schutzgebiets befinden. Sie können nunmehr die gesamte Logistikkette ins Visier nehmen und auch gegen Lagerhalter, Fulfillment-Dienstleister und andere mittelbare Besitzer vorgehen.
Voraussetzung bleibt allerdings, dass die Waren erkennbar für den deutschen Markt bestimmt sind. Indizien hierfür sind deutsche Domain-Endungen, deutschsprachige Websites, die Angabe von Liefergebieten in Deutschland, die Verwendung deutscher Währung oder gezieltes Marketing für deutsche Verbraucher. Reine Transitwaren ohne Deutschlandbezug bleiben weiterhin geschützt.
Neue Herausforderungen für Online-Händler
Für grenzüberschreitend tätige Online-Händler bringt die Entscheidung erhebliche neue Haftungsrisiken mit sich. Der physische Standort der Waren bietet keinen Schutz mehr vor ausländischen Markenrechten, wenn sich die Verkaufsangebote an Verbraucher in anderen EU-Mitgliedstaaten richten. Dies gilt sowohl für eigene Online-Shops als auch für den Verkauf über Marktplätze wie Amazon, eBay oder andere Plattformen.
Online-Händler müssen ihre Markenrechtsprüfungen künftig auf alle Zielmärkte ausweiten, nicht nur auf den Ort ihres Firmensitzes. Wer deutsche Verbraucher beliefern möchte, muss deutsche Markenrechte beachten – unabhängig davon, wo sich das Unternehmen oder die Waren befinden. Dies erfordert eine grundlegende Überarbeitung der bisherigen Compliance-Strategien vieler Unternehmen.
Gleichzeitig müssen Online-Händler auch ihre Verträge mit Logistikdienstleistern überprüfen. Da auch mittelbare Besitzer haftbar gemacht werden können, besteht die Gefahr, dass Lagerhalter oder Fulfillment-Dienstleister ihrerseits Regress nehmen, wenn sie wegen Markenverletzungen in Anspruch genommen werden.
Auswirkungen auf Logistik und Fulfillment
Logistikunternehmen, Lagerhalter und andere Fulfillment-Dienstleister sehen sich mit völlig neuen Haftungsrisiken konfrontiert. Die Entscheidung des EuGH macht deutlich, dass auch sie als mittelbare Besitzer für Markenverletzungen haftbar gemacht werden können, wenn sie markenverletzende Waren lagern oder transportieren.
Dies gilt insbesondere dann, wenn sie über eine gewisse Aufsichts- oder Leitungsbefugnis gegenüber den Waren verfügen. Bei reinen Transportdienstleistungen dürfte diese Voraussetzung seltener erfüllt sein als bei längerfristigen Lagerungsverträgen, bei denen der Dienstleister aktiv in die Abwicklung von Bestellungen eingebunden ist.
Logistikunternehmen werden daher ihre Sorgfaltspflichten überdenken und möglicherweise präventive Markenrechtsprüfungen einführen müssen. Gleichzeitig wird eine vertragliche Absicherung gegen die Auftraggeber noch wichtiger, um Regressansprüche geltend machen zu können, wenn es zu Markenverletzungsverfahren kommt.
Plattformverantwortung im Fokus
Online-Marktplätze und Plattformbetreiber stehen vor der Herausforderung, ihre Notice-and-Takedown-Verfahren für das neue Rechtsbewusstsein zu sensibilisieren. Während sie nach wie vor nicht verpflichtet sind, aktiv nach Markenverletzungen zu suchen, müssen sie auf Hinweise von Markeninhabern angemessen reagieren.
Die erweiterte territoriale Reichweite von Markenrechten bedeutet, dass Plattformen künftig auch Angebote entfernen müssen, die zwar von Händlern aus anderen EU-Ländern stammen, aber gegen nationale Markenrechte des Zielmarkts verstoßen. Dies erfordert möglicherweise eine Anpassung der automatisierten Erkennungssysteme und eine bessere Schulung der Mitarbeiter im Bereich Markenrecht.
Fazit
Für Inhaber nationaler Marken bieten sich durch das Urteil neue Chancen. Markeninhaber können künftig auch gegen den bloßen Besitz rechtsverletzender Ware im EU-Ausland vorgehen auch wenn dort keine Markenrechte bestehen. Voraussetzung ist lediglich, dass diese Waren in das Land verbracht werden sollen, in denen nationaler Markenschutz besteht. Bislang konnte man nur die Angebote im Inland, aber nicht den Besitz im Ausland verbieten.
Wir beraten
Sie gerne zum
Markenrecht!