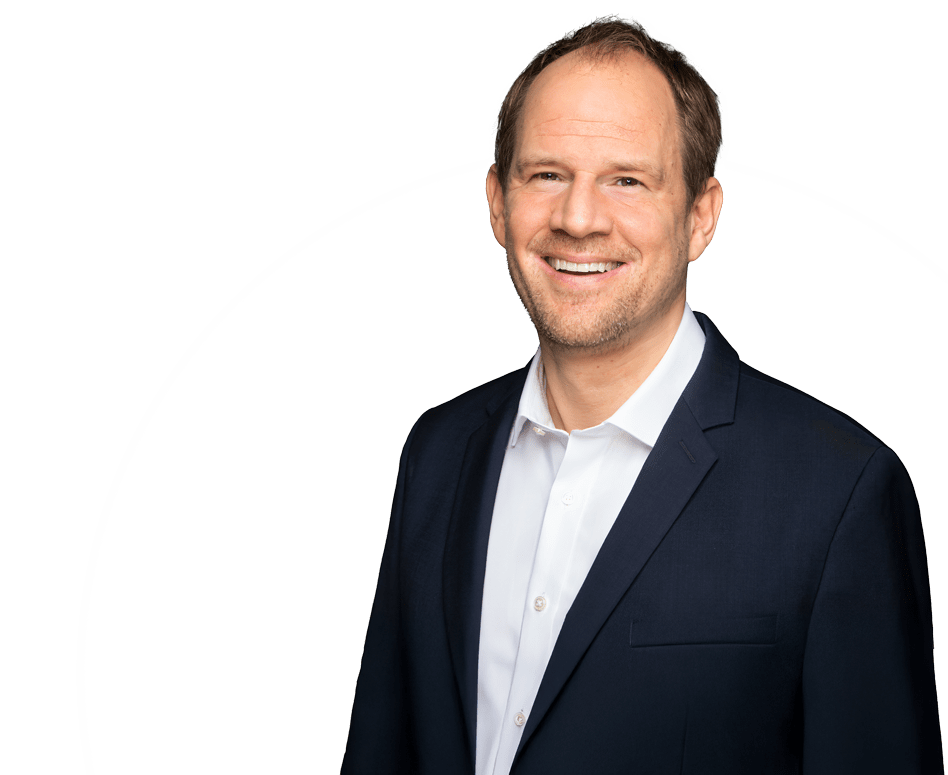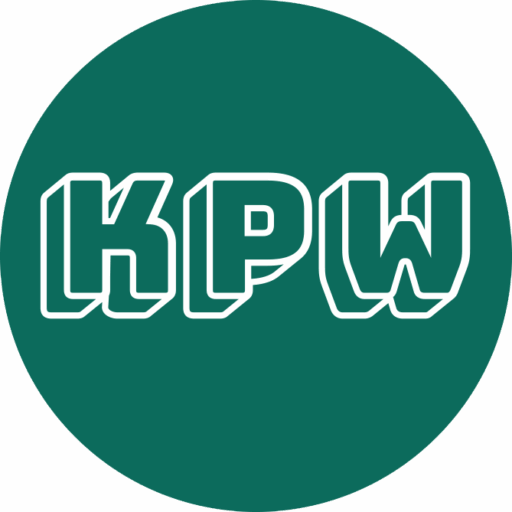Deutsche
Champignons aus
Holland.
Deutsche
Champignons aus
Holland.
von
Darf ein Supermarkt mit „deutschen Champignons“ werben, wenn in der Filiale tatsächlich Ware aus Polen oder den Niederlanden liegt? Und wie lange haben Verbraucherverbände Zeit, um dagegen vorzugehen?
Werbung mit Heimatgefühl – und ihre Tücken
Regionalität verkauft sich gut. Bezeichnungen wie „Deutsche Erdbeeren“, „Äpfel aus der Region“ oder „Champignons aus deutschem Anbau“ wecken Vertrauen, suggerieren Frische, kurze Transportwege und Qualitätsbewusstsein. Doch genau mit dieser emotionalen Aufladung geht auch die Gefahr der Irreführung einher. Stimmen die Herkunftsangaben in der Werbung nicht mit der tatsächlichen Warenherkunft überein, steht schnell der Vorwurf im Raum, Verbraucher zu täuschen – ein klassischer Fall für das Wettbewerbsrecht.
So auch im Fall, den das Oberlandesgericht Köln zu entscheiden hatte. Ein zur REWE Group gehörender Supermarkt hatte in einem Wochenprospekt Champignons mit dem Hinweis „deutsch“ beworben. Als ein aufmerksamer Kunde in der Filiale nachsah, fand er dort jedoch Pilze aus Polen und den Niederlanden. Er informierte die Verbraucherzentrale, die daraufhin Unterlassung verlangte. Das Landgericht gab der Klage statt, doch der Supermarkt ging in Berufung – ohne Erfolg.
Die Entscheidung des OLG Köln
Das Oberlandesgericht Köln bestätigte mit Urteil vom 31.10.2025 – Az. 6 U 34/25 die Unterlassungsverfügung im Wesentlichen.
Nach Auffassung der Richter war die Werbung objektiv irreführend, da sie eine Herkunft suggerierte, die in der Realität nicht gegeben war. Dabei sei es nicht entscheidend, ob die Fehllieferung auf ein Versehen zurückging oder ob die Filiale den Fehler später korrigierte. Ausschlaggebend sei allein, dass Verbraucher zum Zeitpunkt der Werbung und des Kaufs eine falsche Vorstellung über die Herkunft der Ware gewinnen konnten.
Die spannende Nebenfrage: Wann verjährt der Anspruch?
Aus juristischer Sicht ist insbesondere die Frage der Verjährung interessant. Das Wettbewerbsrecht sieht für Unterlassungsansprüche eine extrem kurze Frist von nur sechs Monaten vor. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Anspruchsberechtigte von der Rechtsverletzung und dem Verletzer Kenntnis erlangt. Nach Ansicht des OLG Köln war diese Frist hier bereits abgelaufen, da die Verbraucherzentrale den vollständigen Prospekt bereits im April 2024 kannte und somit über alle wesentlichen Umstände verfügte, um den Anspruch geltend zu machen.
Doch damit war der Fall nicht erledigt. Das OLG Köln stützte den Unterlassungsanspruch zusätzlich auf das Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Verstößen (UKlaG). Nach dieser Regelung können qualifizierte Einrichtungen wie Verbraucherzentralen Unterlassungsansprüche auch auf verbraucherschützende Vorschriften stützen, die der regulären dreijährigen Verjährungsfrist des Bürgerlichen Gesetzbuchs unterliegen. Das Gericht sah die Voraussetzungen hierfür als erfüllt an. Die Vorschriften über irreführende Lebensmittelwerbung dienen dem Verbraucherschutz und fallen somit unter das Verbandsklagerecht. Somit konnte die Verbraucherzentrale den Unterlassungsanspruch auch nach Ablauf der sechsmonatigen UWG-Frist geltend machen.
Prozessuale Weichenstellung: Einheitlicher Streitgegenstand
Prozessual interessant ist die Einschätzung des OLG Köln zur Zuständigkeit. Bei identischem Antrag und gleichem Sachverhalt bilden die Ansprüche aus Wettbewerbsrecht und UKlaG nach Auffassung des Senats einen einheitlichen Streitgegenstand. Das bedeutet: Der Verband kann frei wählen, ob er seine Klage beim Landgericht nach UWG oder beim Oberlandesgericht nach UKlaG einreicht. Das gewählte Gericht hat dann beide Anspruchsgrundlagen zu prüfen.
Mit dieser Auslegung weicht das OLG Köln ausdrücklich von einer Entscheidung des Kammergerichts Berlin vom 05.11.2024 -Az. 5UKl 5/24 ab. Zur Wahrung einer einheitlichen Rechtsprechung ließ der Senat deshalb die Revision zu. Das letzte Wort dürfte damit der Bundesgerichtshof haben.
Bedeutung für die Praxis
Das Urteil ist ein deutliches Signal für Handelsunternehmen und Lebensmittelanbieter. Wer in Prospekten oder Online-Werbung mit der Herkunft seiner Produkte wirbt, muss sicherstellen, dass diese Angabe zum Zeitpunkt des Drucks sowie beim Verkauf in der Filiale zutrifft. Eine nachträgliche Fehlbelieferung oder ein logistisches Missverständnis schützen nicht vor dem Vorwurf der Irreführung.
Besonders in großen Handelsketten mit zentraler Logistik ist die Kontrolle der Warenherkunft anspruchsvoll. Dennoch gilt: Steht „deutsch“ auf dem Plakat, darf im Regal keine ausländische Ware liegen. Unternehmen sollten daher interne Prüfprozesse etablieren, um Herkunftsabweichungen frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren.
Auch das Thema Verjährung verdient Beachtung. Selbst wenn die kurze UWG-Frist von sechs Monaten verstrichen ist, können Verbraucherverbände über das Verbandsklagerecht noch Jahre später Klage einreichen. Unternehmen sollten sich daher nicht auf die kurze Verjährungsfrist im Wettbewerbsrecht verlassen.
Darüber hinaus unterstreicht die Entscheidung die Bedeutung einer sauberen Dokumentation. Fotos, Lieferscheine, interne E-Mails und Reklamationsprotokolle können im Streitfall entscheidend sein.
Fazit
Wenig überraschend gilt, dass, wer mit „deutscher Herkunft“ wirbt, auch Waren entsprechender Herkunft anbieten muss. Das bedeutet für Unternehmen, dass sie sicherstellen müssen, dass Werbung und tatsächliches Angebot übereinstimmen.
Das Urteil macht auch deutlich, dass sich Unternehmen bei Verstößen nicht auf die kurzen Verjährungsfristen nach dem UWG verlassen können. Durch das Verbandsklagenrecht bleibt die Tür für Klagen über einen langen Zeitraum hinweg geöffnet.
Die Auffassung des OLG Köln im Hinblick auf den einheitlichen Streitgegenstand überzeugt indessen nicht, da es für die Ansprüche nach UWG und UKlaG unterschiedliche Zuständigkeiten gibt, die durch die Auffassung des Gerichts unterlaufen würden.
Wir beraten
Sie gerne zum
Wettbewerbsrecht!