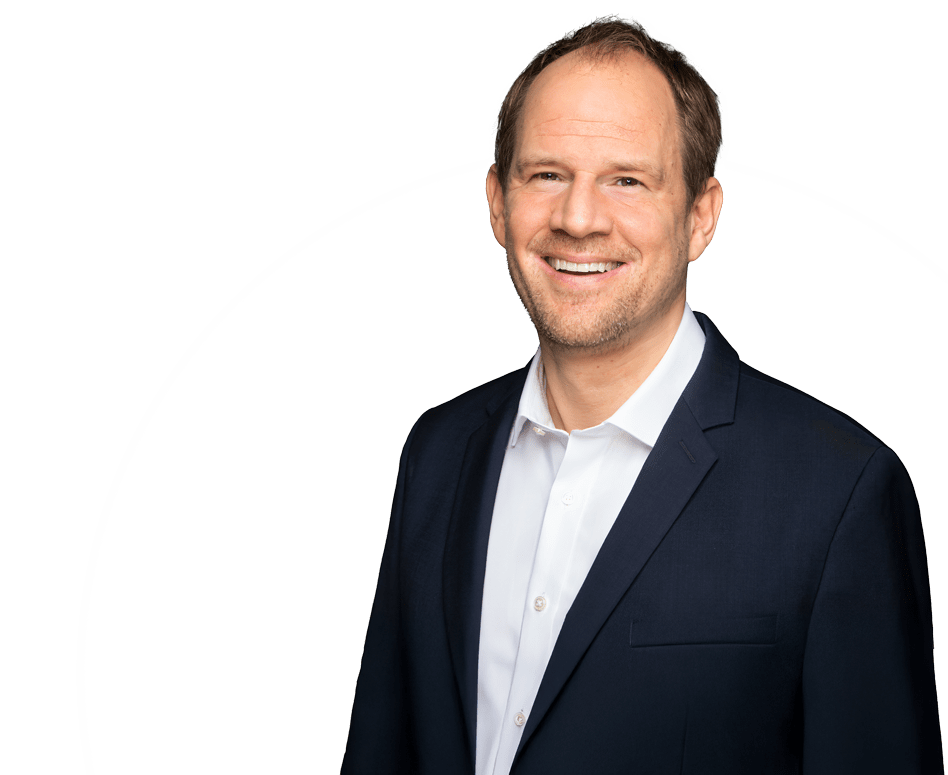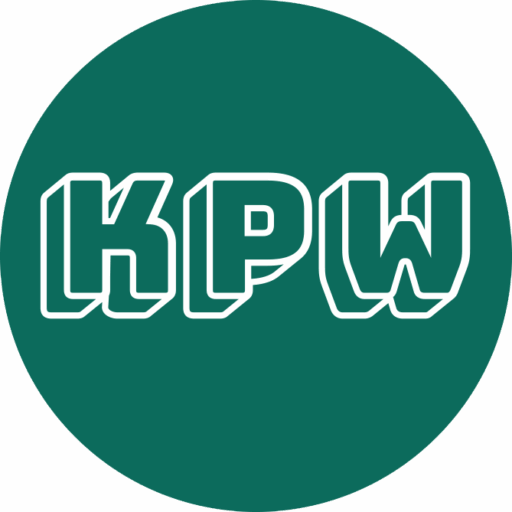Grenzen der
Auskunft im
Markenrecht.
Grenzen der
Auskunft im
Markenrecht.
von
Wie weit gehen Auskunftsansprüche im Markenrecht? Ein aktueller Beschluss des Bundesgerichtshofs zieht klare Linien, wann und in welchem Umfang Informationen über Lieferketten offengelegt werden müssen.
Ausgangspunkt
Ein bekannter Fahrzeughersteller ist Inhaber weltweit bekannter Marken für Landfahrzeuge. Er stellte fest, dass ein Kunde eines Kfz-Teile-Handelsunternehmens über eine Online-Plattform einen gefälschten Luftfilter vertrieb, der mit seinen Marken versehen war. Nach einer Abmahnung gab der Kunde an, das Produkt von dem Kfz-Teile-Handelsunternehmen bezogen zu haben.
Daraufhin verpflichtete sich das Handelsunternehmen, den Vertrieb solcher Produkte zu unterlassen. Der Fahrzeughersteller forderte zusätzlich umfassende Auskünfte über die Herkunft und den Vertriebsweg der mutmaßlich gefälschten Luftfilter, inklusive Namen und Adressen von Herstellern, Lieferanten, Vorbesitzern und gewerblichen Abnehmern sowie Mengen und Preise der betreffenden Waren.
Das Kfz-Teile-Handelsunternehmen erteilte zwar Auskunft, gab jedoch an, dass es aufgrund der internen Lagerorganisation – die Luftfilter würden von verschiedenen Lieferanten gemeinsam gelagert – unmöglich sei, einzelne gefälschte Filter bestimmten Lieferanten oder Abnehmern zuzuordnen. Eine Nachfrage bei den potenziellen Lieferanten habe keine Klarheit gebracht.
Streit um Umfang der Auskunftspflicht im Markenrecht
Das Landgericht verhängte zunächst ein geringes Zwangsgeld, da die Auskunft nur teilweise als erfüllt angesehen wurde. Es vertrat die Auffassung, dass das Handelsunternehmen nicht alle Lieferanten benennen müsse, bei denen keine konkreten Erkenntnisse über die Lieferung von Plagiaten vorlägen.
Das Oberlandesgericht hob das Zwangsgeld auf und stellte fest, dass die Auskunftspflicht entweder vollständig erfüllt sein müsse oder die geforderte Auskunft schlicht unmöglich zu erteilen sei. Es wies die Beschwerde des Fahrzeugherstellers zurück.
BGH zum Umfang der Auskunftspflicht im Markenrecht
Der BGH (Beschluss vom 07.11.2024 – Az. I ZB 31/24) bestätigte die Entscheidung des OLG und wies die Rechtsbeschwerde des Fahrzeugherstellers zurück. Der BGH stellte klar, dass bei der Vollstreckung eines Auskunftsanspruchs streng nach dem Wortlaut des ergangenen Urteils zu verfahren ist.
Ergibt die Auslegung des Vollstreckungstitels über die Erteilung einer Auskunft auf markenrechtlicher Grundlage eine Verpflichtung des Schuldners, dem Gläubiger solche Dritte zu benennen, die markenverletzende Ware an ihn geliefert oder die von ihm markenverletzende Ware erhalten haben, hat der Schuldner nicht alle in Betracht kommenden Lieferanten und Abnehmer zu benennen, bei denen dies lediglich möglicherweise der Fall ist.
Der BGH betonte, dass sich der titulierte Auskunftsanspruch des Fahrzeugherstellers ausschließlich auf jene Lieferanten und Abnehmer bezog, die tatsächlich markenverletzende Ware geliefert oder bezogen hatten. Eine darüber hinausgehende Verpflichtung zur Nennung aller potenziell in Frage kommenden Dritten, wenn eine konkrete Zuordnung unmöglich ist, lehnte der BGH ab.
Der BGH setzte sich auch kritisch mit der Auffassung auseinander, die bei Unmöglichkeit der konkreten Zuordnung eine Pflicht zur Benennung aller in Betracht kommenden Lieferanten annimmt (wie sie teilweise in der Rechtsprechung vertreten wurde). Er stellte klar, dass eine solche Auslegung des vollstreckbaren Titels nicht in Betracht kommt. Sowohl das deutsche Markenrecht als auch die zugrunde liegende EU-Richtlinie begrenzen die Auskunftspflicht nämlich auf diejenigen, die tatsächlich an der Rechtsverletzung beteiligt waren.
Zudem bestätigte der BGH die Feststellung des Oberlandesgerichts, dass die Erfüllung der Auskunftsverpflichtung für das Kfz-Teile-Handelsunternehmen objektiv unmöglich war, da eine Zuordnung der gefälschten Filter zu bestimmten Lieferanten oder Abnehmern aufgrund der internen Lagerhaltung nicht mehr möglich war.
Auswirkungen auf die Praxis
Grenzen der Auskunftsansprüche
Es stärkt die Position von Unternehmen, die mit Auskunftsansprüchen konfrontiert sind. Die Entscheidung macht deutlich, dass sich ein vollstreckbarer Auskunftsanspruch auf konkret nachweislich beteiligte Dritte beschränkt und sich nicht auf eine „Fishing Expedition” in der gesamten Lieferanten- und Kundenliste ausdehnen lässt.
Schutz des Schuldners vor unzumutbaren Pflichten
Wenn ein Unternehmen nachweisen kann, dass es ihm objektiv unmöglich ist, die konkrete Herkunft oder den genauen Vertriebsweg markenverletzender Ware zu identifizieren (zum Beispiel wegen vermischter Lagerbestände), kann es nicht mit Zwangsmitteln zur Offenlegung aller potenziellen Beteiligten gezwungen werden. Dies schützt Betriebsgeheimnisse und verhindert unverhältnismäßige Belastungen.
Erschwernis für Markenrechtsinhaber
Für Markenrechtsinhaber bedeutet dies jedoch eine Herausforderung, da der Kampf gegen Produktfälschungen komplexer werden kann, wenn der Nachweis der konkreten Beteiligung jedes einzelnen Glieds in der Kette erschwert ist. Das Urteil legt die Beweislast für die „Unmöglichkeit” der Auskunft beim Schuldner.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der BGH mit diesem Beschluss die Anforderungen an Auskunftsansprüche in der Vollstreckung präzisiert und das Verhältnis zwischen dem Informationsinteresse des Markenrechtsinhabers und dem Schutz des Unternehmens vor überzogenen Offenlegungspflichten neu ausgleicht.
Für Markenrechtsinhaber bedeutet die Entscheidung eine Herausforderung. Händler die bewusst oder unbewusst nachweislich nicht (mehr) wissen, von wem oder an wen sie rechtsverletzende Waren verkauft haben, schulden nach dem BGH keine Auskunft mehr.
Wir beraten
Sie gerne zum
Markenrecht!