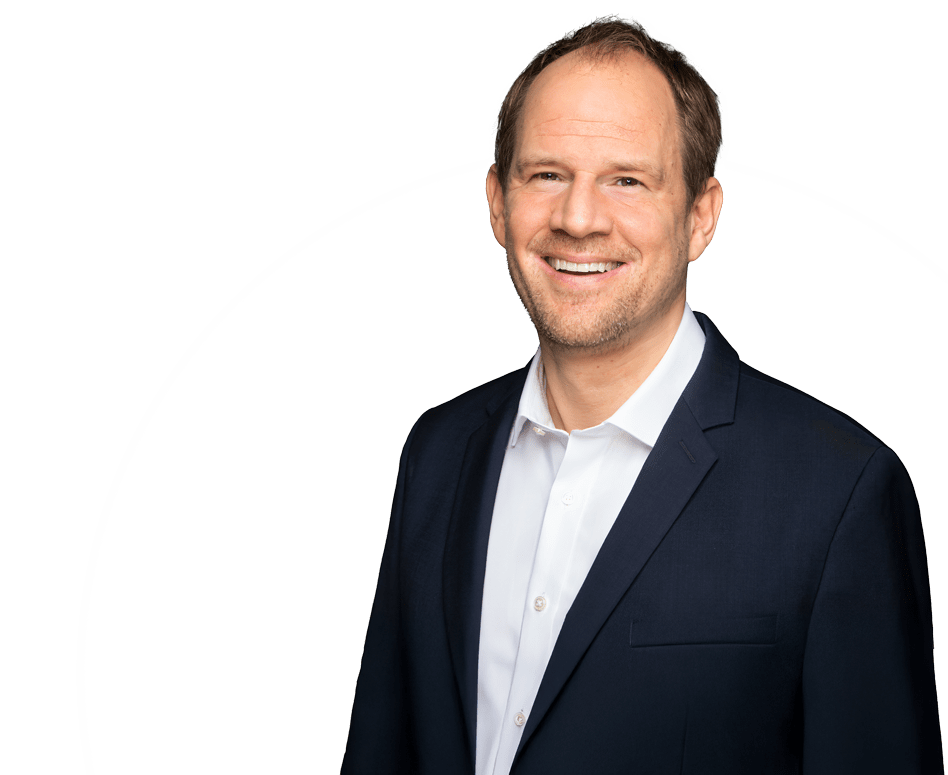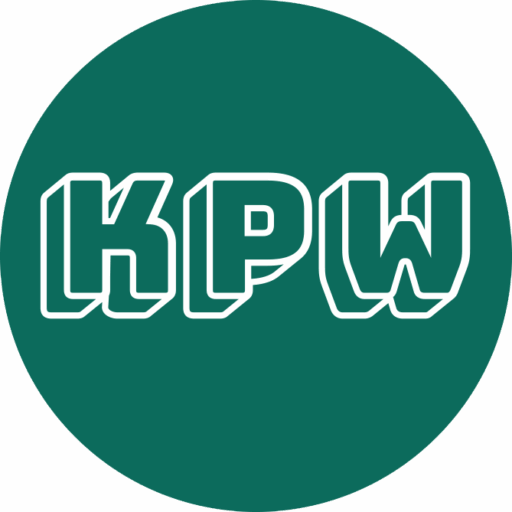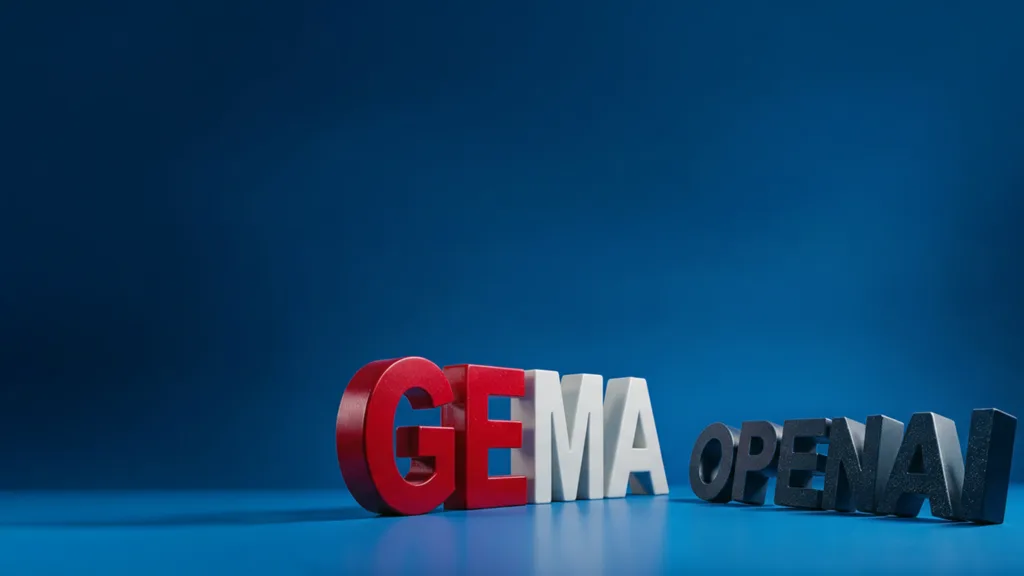
GeMA
siegt gegen
OPENAI.
GeMA
siegt gegen
OPENAI.
von
Kann ein Sprachmodell wie das von OpenAI urheberrechtlich geschützte Liedtexte „auswendig lernen“? Und wenn ja – ist das erlaubt? Das Landgericht München I hat diese Fragen nun in einem aufsehenerregenden Verfahren der GEMA gegen OpenAI beantwortet – mit deutlichen Worten und weitreichenden Folgen für die KI-Branche.
Ein Streit mit Symbolkraft
Die Verwertungsgesellschaft GEMA hatte gegen zwei Unternehmen der OpenAI-Gruppe geklagt. Streitpunkt: In den KI-Modellen GPT-4 und GPT-4o seien Liedtexte deutscher Urheber gespeichert und teilweise auf Nutzeranfragen fast wortgleich ausgegeben worden – darunter bekannte Songs wie
- „Atemlos“ von Kristina Bach
- „Wie schön, dass du geboren bist“ von Rolf Zuckowski.
Die GEMA sah darin eine klare Verletzung der Urheberrechte. OpenAI hielt dagegen: Die Modelle würden keine Texte „speichern“, sondern lediglich Wahrscheinlichkeiten für Sprachmuster abbilden. Wenn ein Nutzer ein Lied erhalte, liege die Verantwortung beim Nutzer – nicht beim System.
Das Urteil: Urheberrechtsverletzung bejaht
Die 42. Zivilkammer des Landgerichts München I folgte mit Urteil vom 11.11.2025 – Az. 42 O 14139/24 der Argumentation der GEMA weitgehend. Sie gab den Ansprüchen auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz im Wesentlichen statt.
Nach Ansicht der Richter liegt bereits durch das Training der Modelle eine Vervielfältigung der Liedtexte vor. Die Texte seien in den Parametern der Modelle „reproduzierbar enthalten“ – also technisch festgelegt und wiederherstellbar. Damit seien sie urheberrechtlich verkörpert und fielen unter das Vervielfältigungsrecht.
Wörtlich heißt es im Urteil:
Die streitgegenständlichen Liedtexte sind reproduzierbar in den Sprachmodellen enthalten. Angesichts der Komplexität und Länge der Liedtexte ist der Zufall als Ursache für deren Wiedergabe ausgeschlossen.
Diese Memorisierung – also das Behalten ganzer Werke im Modell – sei nicht durch die Schranke im Urheberrecht für Text- und Data-Mining gedeckt.
Warum Text- und Data-Mining hier nicht hilft
Das Gericht differenzierte genau:
Beim Text- und Data-Mining geht es darum, Werke automatisiert zu analysieren, um aus ihnen Informationen zu gewinnen. Diese Nutzung ist erlaubt, solange keine wirtschaftlichen Interessen der Urheber beeinträchtigt werden und die Werke nicht dauerhaft vervielfältigt werden.
Im Fall von OpenAI sei jedoch genau das passiert:
Durch die Memorisierung seien vollständige Werke im Modell enthalten – also dauerhaft vervielfältigt und abrufbar. Damit sei die Nutzung nicht mehr rein analytisch, sondern eine eigenständige urheberrechtlich relevante Verwertung.
Eine analoge Anwendung der Schranke lehnte das Gericht strikt ab. Es fehle an einer vergleichbaren Interessenlage: Beim echten Text- und Data-Mining werden nur Daten ausgewertet, beim Modell-Training dagegen Werke selbst übernommen.
Auch die Ausgaben („Outputs“) sind problematisch
Darüber hinaus stellte das Gericht klar, dass auch die Ausgabe der Liedtexte über den Chatbot eine Urheberrechtsverletzung darstellt.
OpenAI sei für die Ausgabe verantwortlich – nicht die Nutzer. Denn die Inhalte würden von den Sprachmodellen generiert, die OpenAI selbst trainiert und betrieben habe.
Damit liege eine öffentliche Wiedergabe vor, die ebenfalls nicht von urheberrechtlichen Schranken gedeckt sei.
Kein Erfolg bei Persönlichkeitsrechtsverletzung
Nur in einem Punkt hatte die GEMA keinen Erfolg:
Soweit sie Ansprüche wegen fehlerhafter Zuschreibung oder Veränderung von Liedtexten geltend gemacht hatte, wies das Gericht diese ab. Hier sah die Kammer keine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts.
Was das Urteil bedeutet
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und liegt auch noch nicht im Volltext vor. Die Entscheidung dürfte jedoch bereits jetzt Signalwirkung für die gesamte KI-Branche haben.
Erstmals wird ein deutsches Gericht gegenüber generativen KI-Sprachmodellen sehr deutlich.
Wenn Sprachmodelle urheberrechtlich geschützte Texte speichern, dann ist das eine Vervielfältigung – und zwar unabhängig davon, ob die Daten nur „statistisch“ erfasst werden.
Für KI-Entwickler bedeutet das:
- Trainingsdaten müssen urheberrechtskonform beschafft werden.
- Die Schranke des Text- und Data-Mining bietet keinen Freibrief für das Trainieren mit urheberrechtlich geschützten Werken.
- Memorisierung geschützter Werke kann zu Schadensersatzpflichten führen.
- Auch bei der Ausgabe (Output) haftet grundsätzlich der Anbieter, nicht der Nutzer.
Für Urheber und Verwertungsgesellschaften stärkt die Entscheidung die Verhandlungsmacht gegenüber KI-Anbietern.
Fazit
Das Landgericht München I zieht eine klare Linie.
KI darf lernen, aber nicht kopieren.
Das Training mit urheberrechtlich geschützten Inhalten ohne Zustimmung der Rechteinhaber stellt keine zulässige Datenauswertung dar, sondern eine urheberrechtliche Vervielfältigung.
Dabei lässt sich die Argumentation des Gerichts auf alle urheberrechtlich geschützten Inhalte übertragen, nicht nur auf Liedtexte.
Es bleibt spannend, ob die Entscheidung Bestand haben wird. Falls ja, dürften OpenAI & Co. erhebliche Schwierigkeiten erwarten.
Zudem dürfte die Diskussion über ein vergütungspflichtiges KI-Training bzw. eine Beteiligung der Urheber an den Einnahmen der KI-Anbieter dadurch neu entfacht werden.
Wir beraten
Sie gerne zum
Urheberrecht!